Ich entwerfe. Räume. Dinge. Gedanken.
Aber im digitalen Raum – vor allem auf Social Media – da entgleitet mir oft der Entwurf.
Ich folge nicht der Intuition. Ich folge dem Algorithmus.
Reaktionen statt Resonanz.
Digitale Plattformen sind nicht neutral. Sie prägen, was wir sehen. Was wir fühlen. Was wir tun.
Das möchte ich besser verstehen – und sichtbar machen.
Zwischen den Welten
Ich bin 1978 geboren – in eine Welt ohne Smartphone, ohne WLAN, ohne Likes.
Meine „sprechende Puppe“ hatte einen Miniplattenspieler im Rücken. Der erste Computer kam am Ende meiner Schulzeit. Internet war ein Luxus und gekoppelt an die Festnetztelefonie: Entweder telefonieren oder surfen. Kein Multitasking. Kein Dauerstream. Kein Mobile Telefon aka Handy. Kam man zu einem Treffen zu spät, wartete der andere – oder ging einfach wieder.
Heute habe ich drei Töchter. Sie kennen die Welt ohne Mobil Telefon und Social Media nicht. Ich kannte den Großteil meines Lebens die Welt in die sie hineinwachsen nicht.
Ich wollte sie begleiten. Vorbereiten. Schützen. Und dafür musste ich zuerst selbst begreifen, wie diese digitale Welt funktioniert. Eine Welt, die am Ende meiner Zwanziger, als die ersten sozialen Plattformen auftauchten, begann. Neugierig und auch ein bisschen skeptisch – habe ich mich irgendwann mit einem Instagram-Account auf den Weg gemacht, diese Welt zu verstehen.
Heute weiß ich, wie Shorts fesseln, wie der Algorithmus filtert, wie Plattformen unsere Aufmerksamkeit monetarisieren.
Ich habe gelernt – und bin dabei auch an meine Grenzen gestoßen.
Die Erschütterung
Im Juni 2025 wurde Graz von einem Amoklauf erschüttert. Eine Schule – ein junger Täter – viele Betroffene.
Meine Schwester war mittendrin. Gerade noch wollte sie Maturant:innen durch ihre Prüfungen begleitet. Dann ging alles ganz schnell.
Es war nicht der erste Vorfall.
Im Mai 2024 wurde der Bereich rund um die Schule meiner ältesten Tochter abgesperrt. Eine Frau stand im Verdacht, eine Bombe im Auto zu haben – mutmaßlich platziert von ihrem Ex-Partner.
Im Dezember 2024 mussten wir unsere beiden jüngeren Mädchen aus der Schule holen. Eine Bombendrohung – ein Fake, aber nicht weniger beunruhigend.
Drei Vorfälle. Ein Jahr. Und jedes Mal ein Stich ins Herz. Auch wenn meiner Familie körperlich nie etwas passiert ist.
Ich war wütend. Traurig. Ohnmächtig.
Und ich habe öffentlich darüber geschrieben – auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn.
Der Zuspruch war groß. Die Reichweite überraschend. Aber das Wichtigste war: Ich habe gespürt, wie viele Menschen ähnlich empfinden.
Ich wollte nicht stehen bleiben in den Gedanken.
Wir brauchen Räume, in denen aus Betroffenheit Beteiligung wird.
Ich will in Bewegung bringen.
Meine Vision
Soziale Medien sind nicht mehr wegzudenken.
Sie sind Teil unseres Alltags, prägen unsere Wahrnehmung – und verändern unsere Gesellschaft.
Doch die Art und Weise, wie sie heute funktionieren – kommerziell, auf Aufmerksamkeit optimiert, oft polarisierend – ist problematisch. Vor allem, aber nicht nur, für unsere Kinder.
Ich glaube nicht, dass wir Social Media abschaffen müssen.
Aber ich glaube, dass wir sie neu denken müssen.
Was wäre, wenn Social Media nicht auf Likes basieren würde – sondern auf Vertrauen? Nicht auf Algorithmen – sondern auf echtem Interesse?
Ich wünsche mir einen Raum, in dem positive Beispiele sichtbar werden.
Einen Ort, an dem Menschen erzählen, wie sie sich engagieren – und andere inspiriert werden sich zu engagieren.
Was ist Social Media eigentlich?
Wie alles begann – und warum es nicht überall gleich ist
Die Geschichte der sozialen Medien begann nicht als globaler Masterplan, sondern als eine Vielzahl von Experimenten – regional geprägt, technisch getrieben, kulturell unterschiedlich interpretiert.
In den USA entwickelten sich soziale Plattformen vor allem aus studentischen Netzwerken heraus:
Plattformen wie Facebook (ursprünglich „TheFacebook“) entstanden auf dem Campus, mit dem Ziel, Menschen online zu verbinden – erst an Universitäten, dann weltweit. Die Infrastruktur war werbefinanziert, wachstumsgetrieben und geprägt von einem unternehmerischen, nahezu evangelischen Glauben an Technologie als gesellschaftliche Lösung.
In Asien, vor allem in China, entstanden etwas zeitversetzt Plattformen wie WeChat, QQ oder TikTok (bzw. Douyin), die tief mit staatlicher Regulierung, Plattform-Konzentration und Mobile-First-Logiken verflochten sind. Dort wurde Social Media von Beginn an mit Services wie Bezahlen, Navigation und Shopping verknüpft – ein digitaler Alltag aus einer Hand. Die Datenhoheit liegt hier häufig bei großen Tech-Konglomeraten mit starker staatlicher Kontrolle.
In Europa verlief die Entwicklung fragmentierter – geprägt durch Datenschutzdebatten, kulturelle Skepsis und strengeren Regulierung. Zwar gab es auch europäische Plattformversuche (z. B. StudiVZ, Wer kennt wen, Lokalisten), doch sie konnten mit der aggressiven Skalierung und Kapitalisierung der US-Plattformen nicht mithalten. Europa ist bis heute eher Konsument als Produzent globaler Plattformstrukturen – und zugleich der Kontinent mit der kritischsten Debatte über deren gesellschaftliche Auswirkungen.

Diese regionalen Unterschiede beeinflussen, wie Plattformen genutzt werden, welche Werte und Normen sie transportieren – und wie wir mit ihnen umgehen.
Was Social Media heute ist – und was daran nicht gut ist
Soziale Medien begleiten heute unseren Alltag.
Wir teilen, scrollen, kommentieren – privat wie beruflich. Fast automatisch.
Doch was ist Social Media eigentlich?
Soziale Medien sind digitale Plattformen, auf denen Menschen Inhalte erstellen, verbreiten und miteinander interagieren können. Dazu zählen Netzwerke wie Instagram, Facebook, TikTok, X (ehemals Twitter), aber auch Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram oder Signal, auf denen in privaten Gruppen oder Broadcasts enorme Reichweiten erzielt werden.
Anders als klassische Medien – etwa Zeitungen, Radio oder Fernsehen – beruhen soziale Medien nicht auf redaktioneller Auswahl, sondern auf Algorithmen.
Während Journalist:innen bei klassischen Medien entscheiden, was veröffentlicht wird, übernehmen diese Rolle bei Social Media automatisierte Systeme, die auswerten, was uns festhält, berührt, empört oder fesselt.
Ziel ist dabei nicht Information, sondern maximale Aufmerksamkeit.
Je länger wir bleiben, desto mehr Daten werden gesammelt – und desto höher der Profit durch Werbung.
Soziale Medien wirken oft wie neutrale Werkzeuge – aber sie sind wirtschaftlich getriebene Systeme, die unsere Verweildauer in Geschäftsmodelle verwandeln.
Das betrifft nicht nur öffentliche Plattformen. Auch private Messenger-Gruppen funktionieren teils nach Social-Media-Logik:
- Inhalte werden schnell und ungeprüft verteilt
- Emotionen entfalten sich ungefiltert
- Informationen zirkulieren in digitalen Echokammern
Was dabei oft auf der Strecke bleibt?
Nuancen. Langsamkeit. Zufall. Vielfalt.
Widersprüche, Fragen, Chancen
Social Media kann Türen öffnen.
Sie können verbinden, sichtbar machen, bewegen.
Ich habe dort tolle Menschen kennengelernt. Kreative Projekte entdeckt. Bereichernden Austausch erlebt.
Ich durfte mitlesen, mitfühlen, mitdenken – in Kreisen, zu denen ich im echten Leben oft keinen Zugang gehabt hätte.
Social Media kann Türen zuschlagen.
Sie können einen einsperren, abgrenzen, erstarren lassen.
Zwischen Idealisierung und Inszenierung. Zwischen Reizüberflutung und digitaler Müdigkeit.
Ich durfte mitlesen, mitfühlen, mitdenken – Ich habe mich auch verloren gefühlt. Unsicher. Hilflos.
Die Plattformen, die uns verbinden sollen, trennen oft – nach Meinungen, Milieus, Mechanismen.
Der Algorithmus zeigt uns, was wir mögen – und hält uns fern von dem, was uns irritieren oder weiterbringen könnte.
Inhalte, die besonders stark polarisieren oder emotionalisieren, werden bevorzugt.
Desinformation verbreitet sich oft schneller als fundierte Inhalte.
In Gruppen entstehen Filterblasen, in denen die eigene Sichtweise verstärkt, aber selten hinterfragt wird.
Als Mutter frage ich mich:
Was bedeutet es für unsere Kinder, wenn Aufmerksamkeit zur Währung wird?
Wenn Selbstbild und Selbstwert in Likes gemessen werden?
Wenn sie lernen, ständig verfügbar zu sein – und sich dabei selbst verlieren?
Als Kreative frage ich mich:
Was passiert mit der Tiefe, wenn Reichweite wichtiger ist als Resonanz?
Wenn Schnelligkeit die neue Qualität ist?
Als Bürgerin frage ich mich:
Wie frei sind wir wirklich, wenn Plattformen entscheiden, was sichtbar wird – und was nicht?
Wenn Aufmerksamkeit gelenkt wird – nicht durch Inhalte, sondern durch Geschäftsmodelle?
Und trotzdem, bei all diesen Fragen – glaube ich an das Potenzial.
Ich glaube, dass wir soziale Medien anders denken, gestalten, nutzen können.
Bewusster. Mutiger. Menschlicher.
Gestalten wir Wandel – gestalten wir Social Media
Deshalb wird als erstes auf dieser Website ein neuer Bereich entstehen
Wandel gestalten
Ein Raum für Orientierung.
Für Fragen statt Antworten. Für Überblick statt Überforderung. Für Klarheit statt Polarisierung.
- Mit einem ehrlichen Überblick über kommerzielle und alternative Plattformen
- Mit ihrer Geschichte, ihren Stärken und Schwächen
- Mit Begriffen, die erklären – nicht abschrecken
- Mit Impulsen, wie wir uns selbst und unsere Kinder begleiten können
- Mit Inspiration, wie wir uns selbst und anderen helfen können
Ich möchte alternative Plattformmodelle sichtbar machen – solche, die sich nicht über Werbung, Likes und Datenhandel finanzieren.
- Genossenschaftlich organisierte Netzwerke, in denen die User nicht Zielgruppe sind, sondern Mitgestalter:innen.
- Gemeinwohlorientierte Plattformen, die offen, föderiert und dezentral funktionieren.
- Datenschutzfreundliche Tools, die nicht alles über uns wissen wollen, um uns besser zu verkaufen.
Diese Modelle gibt es.
Aber sie brauchen Sichtbarkeit, Vertrauen und Menschen, die sie ausprobieren, weiterentwickeln, mittragen.
Die große Herausforderung ist nicht nur technischer Natur.
Sie ist kulturell.
Wir brauchen ein digitales Ökosystem, das nicht auf der Ausbeutung von Aufmerksamkeit basiert, sondern auf Respekt, Autonomie, Kreativität und Verbundenheit.
Ist das utopisch? Vielleicht.
Die Alternative – weiter wie bisher – ist dystopisch.
Veränderung beginnt dort, wo Menschen den Mut haben, sich eine andere Welt vorzustellen. Es ist Zeit, dass wir uns zusammentun – und gemeinsam eine bessere digitale Zukunft gestalten.
Einladung & Ausblick
Wenn dich das Thema auch bewegt – bleib hier.
In den kommenden Wochen entsteht auf handART.at ein neuer Bereich.
Vielleicht nutzt du soziale Medien – und fragst dich manchmal, warum sie sich so anfühlen, wie sie sich anfühlen.
Vielleicht arbeitest du mit Jugendlichen – oder begleitest selbst Kinder auf ihrem digitalen Weg.
Vielleicht willst du einfach wissen, welche Alternativen es gibt – jenseits von TikTok, X und Instagram.
Dann lade ich dich ein: Schau wieder vorbei. Lies mit. Denk mit.
Und wenn du selbst Wissen, Erfahrung oder Ideen beitragen möchtest – dann melde dich. Und mach mit.
„Wandel gestalten“ ist kein Projekt. Es ist ein gemeinsamer Prozess.
Und – ein Anfang.
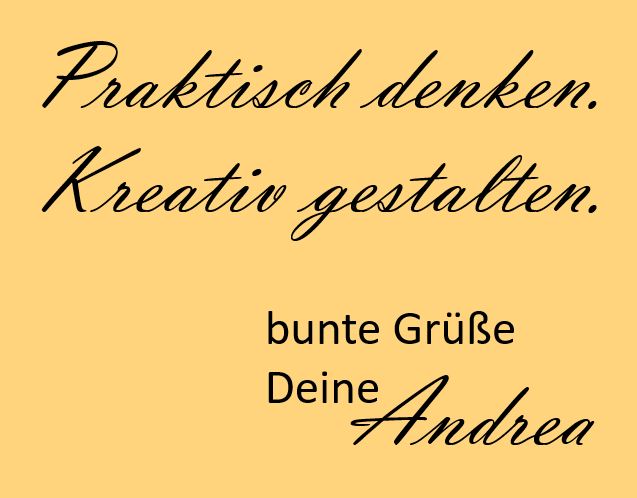





Schreibe einen Kommentar